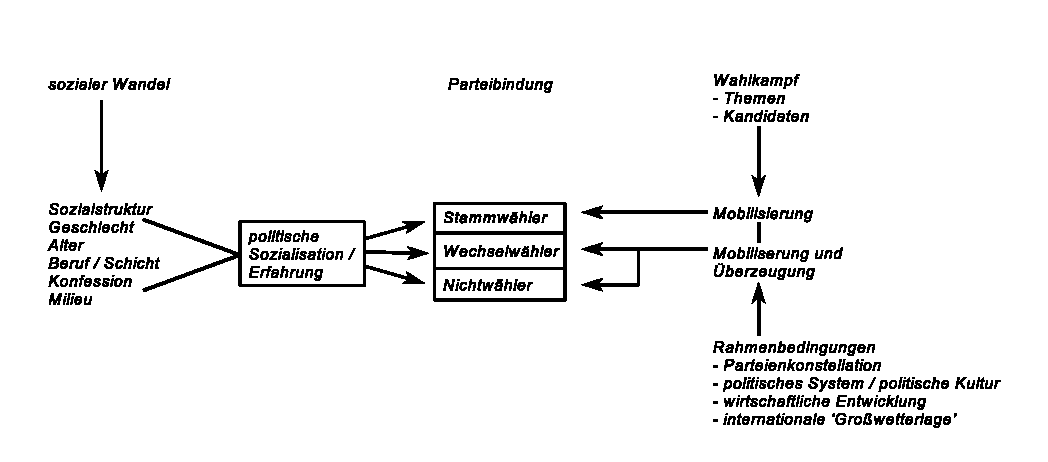
READER zum Thema: Zur Klausur Nr. 3 Politik GK Behn Mai 2002
Wechselwähler - Nichtwähler
Harald Weiss
Wer gewinnt die Wechselwähler im Osten
Magdeburger SPD-Parteitag
Der Spruch ist nicht neu, aber wahr: Gewonnen werden Wahlen zwar in Deutschlands Westen, doch verloren werden sie im Osten: Wem die wechselwählerischen Truppen des Ostens in großer Zahl von der Fahne gehen, kann die Wahlschlacht am 22.September unmöglich gewinnen. Deshalb ähneln sich die Weisheiten und Versprechungen auch so sehr - die des roten Kanzlers heute in Magdeburg und die des schwarzen Kandidaten gestern in Wörlitz. Da wird mehr Geld für Bildung und Forschung zugesagt, für Straßen und Bahnverbindungen, natürlich auch für Stadtentwicklung und Arbeitsmarkt. Soweit, so gut, so ununterscheidbar. Sieger nach Punkten ist Gerhard Schröder immer dann, wenn er den Herausforderer an seiner schwachen Stelle packt: An Stoibers Amt des bayerischen Ministerpräsidenten; das ist für die Menschen im Osten nachvollziehbar. Der Vorwurf lautet: Stoiber habe die Interessen des Freistaats immer über die Interessen Gesamt-Deutschlands gestellt. Indem er jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Finanzausgleich der Krankenkassen klage, nehme er es aus purem bayerischem Eigennutz hin, die Krankenkassenbeiträge im Osten von 14 auf 20 Prozent hochzutreiben. Das wäre in der Tat ein Fiasko für die Arbeitsmarktpolitik, ein Hindernis vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen, im Osten zu investieren. Aber auch die SPD hat ein Thema, bei dem sie über die eigenen Beine stolpert: Es geht um das Dauerärgernis ostdeutscher Sozialdemokraten, dass die Löhne dort nach wie vor niedriger sind als im Westen. Das Dilemma ist ein ernsthaftes: Höhere Lohnkosten halten die dringend gesuchten Investoren ab, andererseits führt ein zu großes Lohngefälle dazu, dass die Jungen und Begabten massenhaft in den Westen abwandern. Was macht nun ein SPD-Kanzler in einer solchen Situation? Er überlässt den Markt den sich selbst regelnden Kräften, und verspricht ersatzweise gleiche Löhne in Ost und West für den Öffentlichen Dienst. Bei den heute schon stark überbesetzten Behörden müssen in der Tat keine Investoren mit Niedriglöhnen gelockt werden. Doch ärgerlich ist, dass für die Mehrkosten stattdessen die Steuerzahler zu bluten haben. Und das Ergebnis ist dennoch dürftig: An die Stelle des Lohngefälles von Ost nach West wird ein Gefälle treten zwischen denen, die sich in der freien Wirtschaft phantasievoll durchschlagen und denen, die es sich bei Vater Staat gut gehen lassen. Aber, wie gesagt, es sind Wahlkampfzeiten – und da gibt es wertvollere Güter als ökonomischen Sachverstand.
10.03.2002
http://www.swr.de/nachrichten/kommentare/2002/03/10/279/
Sind politisch informierte Bürger eher Wechselwähler?
basierend auf einem Aufsatz von Philip E.Converse
"Wie viele und welche Informationen die Wähler erreichen, entscheidet über die Kontinuität des Wahlverhaltens. Am ehesten wechseln nur wenig an Politik interessierte und wenig informierte Wähler die Partei. Politisch sehr interessierte und informierte Wähler haben das stabilste Wahlverhalten."
"Warum entscheiden sich Wähler bei einer politischen Wahl für eine andere Partei als in der Vergangenheit? Welche Rolle spielen dabei die politischen Informationen und Botschaften, die die Wähler aus den Massenmedien beziehen oder im persönlichen Gespräch etwa mit Freunden und Bekannten aufnehmen? Und welche Bedeutung hat das Vorwissen und der Informationsstand der Wähler zu politischen Fragen? Der amerikanische Politikwissenschaftler Philip Converse entwickelte ein Modell, das klären soll, wie die Stabilität bzw. der Wechsel im Wählerverhalten abhängt von dem Zusammenwirken von gesellschaftlichen Informationsflüssen einerseits und dem politischen Vorwissen der Wähler andererseits."
"Drum prüfe, wer sich ewig bindet...
"Eine Art Basislinie der Wahlentscheidung stellt die sogenannte Parteiidentifikation dar, also eine langfristige, emotional getönte Bindung von Wählern an Parteien. Wenn nicht bei einer anstehenden Wahl kurzfristig aktuelle Faktoren, z.B. die öffentliche Diskussion einer politischen Streitfrage, die Wahl einer anderen Partei begünstigen, dann gibt die Parteiidentifikation eines Bürgers vor, welche Partei er wählen wird. Kurzfristig aktuelle Faktoren können natürlich nur dann in die Wahlentscheidung eingehen, wenn die Wähler von ihnen erfahren, etwa durch die Berichterstattung im Fernsehen. Wenn nun, im Extremfall, ein Wähler überhaupt nicht von neuen Informationen zu den Parteien oder zu politischen Streitfragen erreicht würde, sei es, weil nur wenig oder gar nicht berichtet wird, sei es, weil der betreffende Wähler sich nicht für Politik interessiert, entspräche seine Wahlentscheidung ausschließlich seiner langfristigen Parteibindung - sofern er überhaupt zur Wahl ginge."
"Information und Interesse - die Mischung macht's"
"In welchem Ausmaß ein Wähler von aktuellen politischen Informationen
und Botschaften erreicht wird und er insofern zu einer Änderung seiner
Wahlentscheidung bewegt werden könnte, hängt nach Converse also vor
allem von zwei Bedingungen ab: zum einen von dem Angebot an politischer Kommunikation
in einer Gesellschaft, das vor allem durch die Massenmedien bereitgestellt wird,
zum anderen vom Politikinteresse eines Wählers. Für diejenigen Bürger,
die sich auf Dauer überhaupt nicht für politische Fragen interessieren
und die deshalb auch nicht von politischen Informationen erreicht werden, erwartet
Converse ein vollständig stabiles Wahlverhalten im Einklang mit der Parteiidentifikation.
Bei den Wählern mit einem immerhin geringen Interesse an Politik sagt das
Modell von Converse die größte Wahrscheinlichkeit instabilen und
wechselnden Wahlverhaltens voraus, da diese Wähler einerseits von politischen
Botschaften erreicht werden und andererseits aufgrund ihres nur geringen Politikinteresses
und Vorwissens über Politik diesen Botschaften nur wenig an Argumenten
entgegenzusetzen haben. Eine wieder sehr viel größere Stabilität
im Wählerverhalten wird dem Converseschen Modell zufolge für diejenigen
Wähler vorhergesagt, die sich durchschnittlich oder sogar stark für
Politik interessieren. Solche Wähler werden zwar von einer Vielzahl an
politischen Botschaften erreicht, die im Prinzip zu einer Änderung der
Wahlentscheidung führen könnten. Sie können aber auch aus einem
vergleichsweise reichhaltigen Fundus an politischem Vorwissen schöpfen
und sind deswegen nur sehr schwer von ihrem politischen Standpunkt abzubringen."
"Der Klassiker heute"
"Inwieweit gelten nun die theoretischen Überlegungen, die Philip Converse
im Jahre 1962 formulierte, für die Situation einer modernen Mediengesellschaft
wie der Bundesrepublik? In der Presse und den elektronischen Medien wird täglich
umfassend über Politik berichtet. Somit dürfte es insbesondere zu
Zeiten der Wahlkämpfe, die nicht zuletzt auch in den elektronischen Massenmedien
stattfinden, selbst für politisch nur sehr wenig interessierte Wähler
fast unmöglich sein, politische Inhalte vollständig zu umgehen. In
der Kombination könnten somit für einen nicht kleinen Teil der Bevölkerung
beide Bedingungen erfüllt sein, bei denen Philip Converse eine hohe Wechselbereitschaft
der Wähler erwartet: ein eher geringer Informationsstand bei politischen
Fragen und eine gewisse Erreichbarkeit durch politische Inhalte.
"sowinet.dehttp://www.sowinet.de/wahl%5F001/artikel.html
Stoibers Neues Deutschland?
Die Bürger im Osten werden die Bundestagswahl entscheiden
von Liane von Billerbeck
Zuerst die gute Nachricht: Der Westen bleibt berechenbar. Zwei Männer,
Edmund Stoiber und Gerhard Schröder, echte "Macher" (ZDF), "Siegertypen"
(Radio Eins), machen die Wahl unter sich aus. Die Dritte, Angela Merkel, protestantisch,
weiblich, ostdeutsch, hat das Feld geräumt und wird nun gelobt - für
den Rückzug, versteht sich.
Und nun die schlechte Nachricht: Der Osten ist unberechenbar. Trotz elf Jahren Einheit und Solidarpakt II mit 156,5 Milliarden Euro - vor allem im unangepassten Osten wird sich wieder einmal entscheiden, wer die Bundestagswahl gewinnt.
Mentale Unterschiede
Und an wen die Sympathien im Herbst vergeben werden, ist überhaupt nicht sicher. Das wissen auch Schröder und Stoiber. Der erste Test wird die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im April sein. Deshalb überschlagen sich beide Kandidaten mit Beteuerungen, den Osten genau im Blick zu behalten. Denn nirgendwo anders schlägt das Pendel der Wählergunst so stark mal in die eine, mal in die andere Richtung aus. Das war schon 1990, 1994 und 1998 so. Wer am 22. September erfolgreich sein will, muss vor allem zwei Wählergruppen umwerben: die Frauen, sie stellen zwei Millionen mehr Wähler als die Männer - und die Ostdeutschen.
Egal, was im Osten politisch von Angela Merkel gehalten wird: Dass sie jetzt aus dem Rennen ist, spricht aus Ost-Sicht gegen die anderen Kandidaten und den ganzen Westen gleich mit.
Der Berliner Autor Olaf Georg Klein beschreibt das Gefühl in seinem Buch Ihr könnt uns einfach nicht verstehen: Im Osten wird einer im beruflichen Umfeld zuallererst daraufhin abgeklopft, was er oder sie für ein Mensch ist. Kann man sich im Zweifel, in schwierigen Zeiten also, auf sie oder ihn verlassen? Wird diese Frage bejaht, lassen sich auch sachliche Probleme lösen. Denkt jedenfalls der Osten. Im Westen, so Klein, zählen im Berufsleben dagegen zuerst sachliche Argumente. Der Mensch als Mensch kommt erst danach. Das sind mentale Unterschiede, die den normalen Wahlforscher vermutlich nicht sonderlich interessieren. Von politischer Brisanz sind sie trotzdem. So konstatierte die Forschungsgruppe Wahlen schon 1990, dass zwischen Elbe und Oder das "Potenzial der Wechselwähler größer ist, weil das Wahlverhalten dort stärker problemorientiert" ist. Die soziale Herkunft sagt nichts darüber aus, wo das Kreuz gemacht wird. So dominierte in der großen Berufsgruppe der Arbeiter 1990 - anders als im Westen - die CDU mit immerhin 50 Prozent. Warum? Weil die Arbeiter ganz aktuelle Wünsche erfüllt sehen wollten: "Schnelle Einheit und damit schnelle Angleichung an das westliche Konsumniveau". Kohl hatte genau das versprochen, dieses Versprechen sollte er einlösen. Typisch für den Osten: Eine langfristige Bindung an eine Partei wird nicht gesucht. Man leiht seine Stimme mal der einen, mal der anderen. Ausnahme: die PDS. Doch sie ist nicht "die Ost-Partei" - 80 Prozent wählten sie bei der letzten Bundestagswahl in den neuen Ländern nicht. Vor acht Jahren konnte Kohls CDU noch einmal die Wahlen gewinnen. Das lag daran, dass die Partei im Westen ihre Stammwählerschaft mobilisieren konnte. Aber ähnlich bedeutsam: Im Osten wurde die Union immerhin noch von 41,4 Prozent der Arbeiter gewählt. Nur 35 Prozent gaben der SPD ihre Stimme.
Anders dann 1998. Eine Woche vor der Bundestagswahl bezeichneten 85 Prozent der Befragten die Arbeitslosigkeit als dringendstes Problem. Zwar blühten die ostdeutschen Landschaften, aber nur, weil die Industrieschlote nicht mehr rauchten. Neue Arbeitsplätze? Fehlanzeige. Die Folge: Der Wähler im Osten orientierte sich politisch um. Kurzfristig, schnell, gnadenlos. Die Wanderungsbilanz: Die Union verlor insgesamt rund 1,4 Millionen Wähler an die SPD. Davon kamen knapp eine Million aus den alten, aber 450 000 aus den neuen Ländern, in denen aber fünfmal weniger Menschen wohnen. Der Osten hatte also deutlich mehr Wähler bewegt. Das unterscheidet Deutschland-Ost von Deutschland-West. Zwar lassen auch in den alten Ländern die Parteibindungen nach. Aber im Westen sind sie noch stärker, überdauern selbst Krisenzeiten und große Enttäuschungen. Anders im Osten. Solche Bindungen existieren dort nicht. Deshalb wählen die Ostdeutschen mal die Union, mal die SPD oder die PDS. Oder sie verweigern sich ganz.
Auch für Bündnis 90/Grüne sehen die Prognosen für das Wahljahr 2002 nicht eben rosig aus. Zudem wird der Bundestag verkleinert. In solchen Zeiten strickt man in den westlich dominierten Parteigremien gern nach dem Muster: "Eins rechts, eins links, den Osten fallen lassen." So wird im Bundesland Berlin das Duell um den zweiten grünen Listenplatz für den Bundestag - den ersten besetzt Ministerin Renate Künast - von der Öffentlichkeit nur noch als Kampf zwischen Exgesundheitsministerin Andrea Fischer und Christian Ströbele wahrgenommen. Der dritte Bewerber, der Ostdeutsche Werner Schulz, in der Fraktion für das nicht ganz unwichtige Thema Wirtschaft und Aufbau Ost zuständig, kommt in den Debatten kaum noch vor.
Kein Wunder, dass sich die PDS im Osten als wahre Vertreterin ostdeutscher Interessen profilieren kann. Alle anderen Parteien wirken wie westdeutsche Gewächse mit östlichen Ablegern. Die schlichte Erkenntnis kommt wohl zu spät: Strategische Entscheidungen für den Osten werden entwertet, wenn man das eigene Personal von dort nicht ernst nimmt.
Was heißt das für die kommende Bundestagswahl? Lehre Nummer eins: Abgesehen von denen, die gar nicht wählen werden - und ihre Zahl dürfte zunehmen -, wird sich der Osten für den Kandidaten entscheiden, dem er, erst kurz vor dem 22. September, zutraut, die Probleme schneller als sein Konkurrent zu lösen. Ob das Stoiber ist? Der sieggewohnte Bayer trifft auf ein ihm unbekanntes, neues Deutschland und man wird ihn dort skeptisch mustern, als käme er von einem andern Stern. Oder reicht es noch einmal, sehr knapp, für Gerhard Schröder? Der hat seine "Chefsache" schon öfter besucht. Sicher: Es wird ein Wahlkampf großer Versprechungen werden.
Rasante Wechsel
Lehre Nummer zwei: Wer den Osten gewinnen will, muss "verlässlich" sein, denn dieses Wort wiegt jenseits der Elbe besonders schwer. "Sag mir, wo du stehst", sang ein FDJ-Singeklub zu DDR-Zeiten, und dieser Satz gilt noch immer. Bist du für oder gegen uns? - Bist du für oder gegen den Afghanistan-Krieg? Das sind die im Westen ganz unüblichen Fragen, an deren Beantwortung sich entscheidet, ob einer im Osten ankommt oder eben nicht. Politik wird östlich der Elbe längst noch nicht so sportlich genommen oder längst nicht so zynisch wie im Westen. Die Ostdeutschen haben 1989 existenziell erlebt, was Politik ändern kann. Sie haben es ja selbst vorgemacht. Aus dieser Erfahrung wuchsen Hoffnungen - und Enttäuschungen gleichermaßen.
Lehre Nummer drei: Im Osten läuft heute schon im Zeitraffertempo ab, was dem Westen noch bevorsteht - die Erosion der politischen Bindungen an eine Partei, der rasante Wechsel von Rot zu Schwarz und wieder zurück, je nach den aktuellen Erwartungen des Wählers. Wo die Unterschiede zwischen den großen Parteien abnehmen, weil deren tatsächliche Spielräume enger werden, da können wenige Stimmen viel bewirken, ja, wahlentscheidend sein. Dass der Osten dabei längst schon wieder "auf der Kippe" steht, wie Wolfgang Thierse, SPD, es nannte, oder "an der Weggabelung", wie Günther Nooke, CDU, meinte, spielt dann keine Rolle mehr. Man kann die Wahl im Osten vielleicht nicht gewinnen, verlieren kann man sie dort allemal.
DIE ZEIT Politik 04/2002
Sind die Wähler individualisierter geworden?
_ basierend auf einem Aufsatz von Rainer Schnell und Ulrich Kohler
Die Erklärungskraft sozial-demographischer Merkmale wie Beruf, Geschlecht
und sozialer Schicht für das Wahlverhalten hat abgenommen. Ob aber die
Wähler tatsächlich individualisierter als früher entscheiden,
bleibt in der Forschung umstritten.
Individualisierung ist in den letzten Jahren zu einem vieldiskutierten Begriff in den Sozialwissenschaften avanciert. Darunter fasst man, unter anderem, so verschiedenartige Entwicklungen wie die Auflösung traditioneller sozialer Milieus, eine gewachsene soziale Mobilität oder den Anstieg der Scheidungszahlen. Auch im Hinblick auf das Wählerverhalten wird von einer steigenden Individualisierung gesprochen. Gemeint ist damit, dass die Vorhersagbarkeit der einzelnen Wahlentscheidung im Laufe der Jahre immer geringer geworden ist. Wähler rechneten sich nicht mehr ihr gesamtes Leben lang nur ein oder zwei sozialen Gruppen zu, welche dann durch klare Wahlnormen die parteipolitische Präferenz festlegten. In der Gegenwart gehörten Individuen vielmehr einer weit größeren Zahl sozialer Kategorien an, sie würden ihre Gruppenzugehörigkeiten häufiger wechseln, und schließlich sei auch der Charakter einer sozialen Gruppe häufiger im Wandel begriffen als noch in früheren Zeiten. Jede einzelne soziale Gruppe würde deswegen nach und nach an prägendem Einfluss auf die Wahlentscheidung ihrer Mitglieder verlieren.
Wahlabsicht scheint schlechter vorhersagbar
Eine mögliche Folge von Individualisierung wäre dann, dass sozial-demographische
Merkmale wie die Schichtzugehörigkeit, das Geschlecht oder die Konfession
über die Jahre hinweg in den gängigen statistischen Modellen an "Erklärungskraft"
für das Wählerverhalten verloren hätten. Schnell und Kohler (1995)
untersuchen diese Hypothese für den Zeitraum von 1953 bis 1992 anhand einer
Reihe von Umfragestudien für die Bundesrepublik Deutschland. Sie finden
in der Tat, dass die Vorhersagbarkeit der individuellen Wahlabsicht durch die
sozial-demographischen Merkmale der Befragten im Zeitverlauf nachgelassen hat:
Es zeigt sich ein klarer Rückgang in der Erklärungskraft ihres statistischen
Modells für den untersuchten Zeitraum.
Freilich gilt dies nicht für alle sozial-demographischen Merkmale in gleichem
Maß. Der eindeutig stärkste Rückgang an Erklärungskraft
ist für die Klassen- bzw. Schichtzugehörigkeit festzustellen. Zwar
ist die soziale Klasse unter den sozial-demographischen Merkmalen nach wie vor
ein wichtiges Moment der Wahlentscheidung, sie hat aber deutlich an Einfluss
verloren. Alles in allem stehen die Ergebnisse von Schnell und Kohler damit
im Einklang mit der These einer Individualisierung des Wählerverhaltens.
Ergebnisse noch zu grob?
Ihre Analysen sind jedoch nicht ohne Widerspruch geblieben. So
hebt Walter Müller (1997) kritisch hervor, dass vor allem die Klassen-
bzw. Schichtzugehörigkeit in der Gegenwart sehr viel feiner gemessen werden
müsse als noch in den fünfziger oder sechziger Jahren. Besonders die
stark angewachsene Gruppe der Angestellten und Beamten sei intern sehr heterogen
und habe je nach Teilgruppe recht unterschiedliche Interessenlagen. Während
etwa auch angestellte Manager aufgrund ihrer wirtschaftlichen Interessen eher
der CDU nahe stehen, würden die in sozialen und kulturellen Diensten Beschäftigten
eher zur SPD oder zu den Grünen tendieren. Stelle man solche Unterschiede
in Rechnung, so lasse sich der Befund einer generellen Verringerung der Erklärungskraft
sozial-demographischer Merkmale nicht aufrechterhalten. Es sei deshalb voreilig,
von einer Individualisierung des Wählerverhaltens zu sprechen.
Und schließlich bedeutet die Feststellung, dass die Vorhersagbarkeit der
Wahlabsicht im Durchschnitt abnimmt, nicht, dass es gar keine sozialen Gruppen
mit klaren Wahlnormen mehr gäbe: Streng katholische Bauern wählen
nach wie vor recht sicher eine Partei mit dem "C" im Namen. Doch ist
es mindestens ebenso sicher, dass die Zahl katholischer Bauern abnimmt...
http://www.sowinet.de/wahl%5F003/artikel.html
Text in Abschnitte gliedern - Didaktische Hinweise
Diese Übung dient dem analytischen Umgang mit Texten. Durch
das Gliedern in Abschnitte wird ein Textstrukturiert und überschaubar.
Die Schüler/innen sollen lernen, einen Text als einen aus Sinnabschnitten
bestehendes Ganzes zu erkennen.
Der Wechselwähler
Als Wechselwähler wird der Wähler bezeichnet, der z.B. bei zwei aufeinander
folgenden gleichen Wahlen
(also z.B. bei zwei Bundestagswahlen) für verschiedene Parteien gestimmt
hat. Der Anteil der Wechselwähler hat deutlich zugenommen und wird auf
fast 40 Prozent geschätzt; er scheint jedoch in den 80er Jahren zugenommen
zu haben. Die politische Einschätzung der Wechselwähler variiert zwischen
"Flugsand" der Demokratie und dem Typus des besonders rational abwägenden
Wählers.
Fragt man nach den Voraussetzungen für Wechselwählerverhalten, setzt
eine Erklärung bei den
sozialstrukturellen Einflussfaktoren an. Bei Wählergruppen mit gegenläufigen
Bindungen wird angenommen,
daß sie in ihrer parteipolitischen Orientierung offener sind. Dies gilt
z.B. für gewerkschaftlich gebundene
Arbeiter, die gleichzeitig kirchlich engagiert sind. Bei dieser Gruppe dürften
sich Einflüsse von SPD und
Union kreuzen. Die Bereitschaft, bei Wahlen einmal die Partei zu wechseln, dürfte
aus ähnlichen
Überlegungen heraus auch wachsen, wenn im unmittelbaren Kontaktkreis unterschiedliche
politische
Vorstellungen und Parteiorientierungen vertreten sind. Eine wachsende Gruppe
mit einem relativ hohen
Anteil an Wechselwählern, die dementsprechend auch das Ziel besonderer
Parteianstrengungen ist, stellt der neue Mittelstand (Beamte, Angestellte) dar.
Die Ursachen für Wechselwählerverhalten müssen aber nicht nur
in Faktoren der sozialen Umwelt gesucht, sie können auch im wachsenden
Gewicht politischer Sach- und Personalfragen gesehen werden. Unter dem personellen
Aspekt sind vor allem die Kanzlerkandidaten ein Einflussfaktor. Bei den politischen
Themen gilt, daß ihr Einfluß auf das Wählerverhalten um so
größer ist, je mehr der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
Das Thema muß die Aufmerksamkeit des Wählers erregen, wobei die Massenmedien
eine wichtige Rolle spielen; der Wähler muß sich in seiner Interessenlage
betroffen sehen; er muß das Thema mit den Parteien verknüpfen, indem
er ihnen Schuld oder Verdienst zuspricht oder erwartet, daß sie in bestimmter
Weise reagieren. Dabei geht es weniger um detaillierte Problemlösungen,
als darum, wem der Wähler die Lösungskompetenz zuschreibt. Das Urteil
des Wählers entsteht nicht im politisch luftleeren Raum. Es wird u.a. von
Massenmedien, sozialen Kontakten, Gruppenbindungen beeinflusst. Für Stammwähler
gilt, daß sie gerade bei komplexen Problemen häufig bereit sind,
die Bewertung ihrer Partei zu übernehmen. Je stärker sich der Wähler
allerdings unmittelbar von politischen Ereignissen betroffen sieht und je eher
er sich ein selbständiges Urteil zutraut, desto unabhängiger reagiert
er. Die Erfahrung lehrt, daß in der Regel innenpolitische Themen für
das Wählerverhalten bedeutsamer sind als außenpolitische. Unter dem
Gesichtspunkt der direkten Betroffenheit wird auch verständlich, daß
in der Geschichte der Bundesrepublik wirtschaftliche Fragen das Wählerverhalten
besonders stark beeinflusst haben. Einmal besitzen wirtschaftliche Ziele innerhalb
des Zielkatalogs der meisten Wähler besonderes Gewicht, zum anderen sind
die Folgen wirtschaftlicher Fehlentwicklungen, insbesondere Arbeitslosigkeit
und Inflation, für die meisten Wähler direkt spürbar.
Aus: W. Woyke: Stichwort: Wahlen, 8. überarb. Aufl., Opladen
1994, S. 202 ff.
Uwe Backes und Eckhard Jesse
Die politischen Parteien hatten es in Deutschland schwer, sich in einem langwierigen historischen Entwicklungsprozeß gegen obrigkeitsstaatliche Vor- und Fehlurteile durchzusetzen. Lange Zeit galten Parteien als gemeinwohlschädigend. Die Rede vom "Parteibonzentum" und "Parteiengezänk" war nicht nur in autoritär-konservativen und nationalistischen Kreisen der Weimarer Republik gang und gäbe. Auch die Parteiendemokratie der Bundesrepublik Deutschland sah sich zunächst einem aus obrigkeitsstaatlichen Traditionen gespeisten Mißtrauen in Teilen der Bevölkerung ausgesetzt. Parteienfeindliche Ressentiments konnten zwar mehr und mehr zugunsten eines besseren Verständnisses der Funktionsweise moderner Demokratien abgebaut werden, aber gerade in den letzten Jahren sind alte Vorurteile in neuem Gewand wieder aufgetreten.
Von der "Politik-", der "Politiker-" und auch der "Parteienverdrossenheit" ist viel die Rede. Das Phänomen läßt sich nicht wegdiskutieren, zeigen doch demoskopische Untersuchungen, daß das Vertrauen der Bevölkerung in die demokratischen Parteien und ihre Repräsentanten nachgelassen hat. Die Parteienverdrossenheit findet ihren Niederschlag in einer abnehmenden Wahlbeteiligung, im Schrumpfen der Stammwählerschaft der großen Parteien und in einem Rückgang der Mitgliederzahlen. Freilich sollte man die Lage nicht dramatisieren, zeugen die genannten Indikatoren doch auch von Angleichungsprozessen der deutschen Demokratie an ihre westlichen Nachbarn (z. B. bei der Wahlbeteiligung). Die Schwierigkeiten der großen Parteien resultieren zum Teil aus Auflösungsprozessen sozial-kultureller Milieus, die ehedem dem Wahlverhalten Stabilität verliehen.
Der Rückgang der Mitgliederzahlen hält sich bei langfristiger Betrachtung in Grenzen. Auch die GRÜNEN waren zeitweilig davon betroffen. Allerdings sind sie die einzige der im Bundestag vertretenen Parteien, die seit 1992 wieder wachsende Mitgliederzahlen verbuchen kann. Einer der Gründe dürfte in ihrem besonderen Bemühen um "Basisnähe" und in der relativen Offenheit gegenüber unkonventionellen Formen politischer Betätigung zu sehen sein, die vor allem von Teilen der jüngeren Generation einem Engagement in den oft als schwerfällig und überorganisiert empfundenen großen Parteien vorgezogen werden.
Zweifellos steht es um das Ansehen der demokratischen Parteien nicht zum Besten. Eine Kette von Skandalen hat der Parteienverdrossenheit reichlich Nahrung verschafft. Die Parteispendenaffäre, die Aufdeckung illegaler Praktiken der Geldbeschaffung, die damit verbundene Befürchtung, wirtschaftliche Macht könnte für politische Zwecke mißbraucht werden, die Verstrickung prominenter Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, der Verdacht persönlicher Bereicherung gar - all dies hat den Ruf der Parteien in der Öffentlichkeit schwer beschädigt. Viele junge Menschen finden durch die Skandale und Affären bestätigt, was sie schon immer gewußt zu haben glauben. Der kultivierte Antiparteienaffekt ist mitunter Folge einer Skepsis oder gar ablehnenden Haltung gegenüber dem System der parlamentarischen Demokratie. Den "etablierten" Parteien wird vorgeworfen, nicht auf des Volkes Stimme zu hören; Parteiführung und -basis hätten sich einander entfremdet. Die Politiker in der Bundeshauptstadt säßen quasi in einer "Raumstation", taub geworden für die "wahren" Interessen der breiten Bevölkerung. Hier klingt nicht zuletzt eine Kritikrichtung an, die von einem "homogenen" Volkswillen ausgeht: Die Parteien dienten nicht dem "Gemeinwohl", sondern lediglich tonangebenden gesellschaftlichen Gruppen.
Allerdings zeigen Parteienkritiker keine prinzipiellen Alternativen zur Parteiendemokratie auf. Gleichwohl mangelt es nicht an Reformvorschlägen gegen Übermacht und Machtmißbrauch der Parteien. Aus dem Bereich der außerparlamentarischen Protestbewegungen kristallisierte sich eine Partei heraus (die GRÜNEN), die sich im Laufe der Jahre immer mehr dem Erscheinungsbild der anderen Parteien angeglichen hat. Parteien sind ein unverzichtbares Funktionselement freiheitlicher Demokratie. Sie formen maßgeblich die politische Willensbildung. Die Lebensfähigkeit der Demokratie ist wesentlich von der Qualität der politischen Parteien, der Flexibilität, mit der sie auf neue Herausforderungen reagieren, und der Stabilität des Parteiensystems abhängig.
Wenn prinzipielle Kritik am Parteienwesen auch unvereinbar mit dem Eintreten
für eine freiheitliche Demokratie erscheint, so kann dies doch nicht den
Verzicht auf eine schonungslose Offenlegung von Mängeln und Strukturschwächen
der Parteiendemokratie bedeuten. Im Gegenteil, gerade die Einsicht in die Bedeutung
politischer Parteien für eine funktionierende Demokratie mag die Erkenntnis
fördern, daß diese Kritik notwendig ist. Denn die Leistungsfähigkeit
des politischen Systems hängt auch davon ab, in welchem Maße die
Parteien ihre Aufgaben erfüllen. Sie müssen ihr Wirken mit den sich
stetig verändernden Lebensbedingungen und Anforderungen abstimmen, die
an ihre "Problemlösungskompetenz" in einer hochtechnisierten
Industriegesellschaft gestellt werden. Das Anprangern von Mißständen
kann hierzu beitragen und einer verbreiteten Parteienverdrossenheit entgegenwirken,
die nicht allein auf Vorurteilen gründet.
Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn
Wahlbeteiligung: Nichtwähler und Protestwähler
Die Beteiligung der Bürger der Bundesrepublik Deutschland an den Wahlen
hat seit 1949 auf allen Ebenen des politischen Systems abgenommen. In den letzten
zehn Jahren hat sich die Zahl der Nichtwähler verdoppelt.
Die einen sehen in der mäßig sinkenden Quote eine zunehmende Delegitimierung der Parteien bzw. des gesamten politischen Systems. Sie interpretieren die sinkende Wahlbeteiligung in den alten Bundesländern als Ausdruck von Protest. Als Ursachen werden genannt:
Für andere wiederum ist eine niedrigere Wahlbeteiligung ein Zeichen für Zufriedenheit, wenn gleichzeitig der »system support« insgesamt stimmt. So spiegelt die sinkende Wahlbeteiligung - folgt man dieser Argumentation - einen Normalisierungstrend wider.
Die empirischen Befunde bewegen sich auf zwei Ebenen. Zunächst zeigt der Vergleich mit der Situation in anderen Demokratien, daß die deutschen Beteiligungsquoten keineswegs in bedrohlicher Weise abgenommen haben. Im allgemeinen wird vielmehr hervorgehoben, daß inzwischen auch die Deutschen ihre »Untertanenmentalität« der fünfziger Jahre abgebaut und alte Werte hierbei an Bedeutung verloren haben. Nichtwahl, Protestwahl und Parteienwechsel werden zu akzeptierten Alternativen.
Weiterhin gelang es, Typen von Nichtwählern zu identifizieren und vorsichtig
auch zu quantifizieren. Neben den verdrossenen, mit der Politik unzufriedenen
Wählern existieren Gruppen, in deren Leben Politik kaum oder nur eine geringe
Rolle spielt, etwa saturierte Mittelschichten, junge Individualisten oder auch
gesellschaftliche Randgruppen. Insbesondere bei ökonomisch erfolgreicheren,
politisch jedoch ungebundeneren Gruppen stieg der Anteil der Nichtwähler
in den vergangenen Jahren in allen sozialen Gruppen an.
Ulrich von Alemann: Die Parteien in den Wechsel-Jahren?
In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung
Das Parlament, B 6/96 vom 2. Februar 1996, S. 7f.
Dienstleistungs-Organisationen
Die Krisensymptome sind unübersehbar - den Parteien laufen die Mitglieder
und Wähler davon, die Jugendlichen können sich erst recht nicht für
die mühselige Parteiarbeit erwärmen. Die Wahlbeteiligung sinkt, das
Ansehen der Parteien und Politiker ebenfalls. Forscht man nach den tieferen
Ursachen, so können diese nicht nur hausgemacht sein. Denn die sinkende
Identifikation mit Parteien ist in allen Industriestaaten weit verbreitet. Sicher
ist der Wertewandel dafür mitverantwortlich, der eine Folge des ökonomischen
Wachstums und der sozialen Sicherheit ist. Postmaterialistische Orientierungen
wachsen.
Aber auch der Individualismus nimmt zu und der Trend zu einer "Erlebnisgesellschaft", in der der einzelne kurzfristige Befriedigung seiner Bedürfnisse und Interessen sucht. Die Parteien sind wie alle Großorganisationen von diesen Trends massiv betroffen und werden sich ändern müssen. [...]
Nicht die Abschaffung der Parteiendemokratie, sondern ihre Reform und demokratische Stärkung muß die Alternative sein. Die Debatte um die Parteien- und Politikverdrossenheit ist nicht spurlos an den Parteien in Deutschland vorbeigegangen. Sie beschäftigen sich ja generell gerne mit sich selbst. Zwar gab es auch in den Parteien die Meinung, diese massive Kritik sei ein reines Medienphänomen und die Journalisten würden Skandale und Mißstände nur hochjubeln, um die Auflage zu steigern. Als Reaktion auf die Kritik gibt es aber auch viele selbstkritische Töne.
Die Parteien müssen sich stärker als Dienstleistungsorganisationen
für ihre Mitglieder und insbesondere für ihre Wähler begreifen.
Sie beschäftigen sich zu sehr mit sich selbst. Die Mitgliedschaft muß
für Außenstehende geöffnet, den Meinungen und Werten der Wähler
stärker Rechnung getragen und das interne Management der Organisation muß
professionalisiert werden.
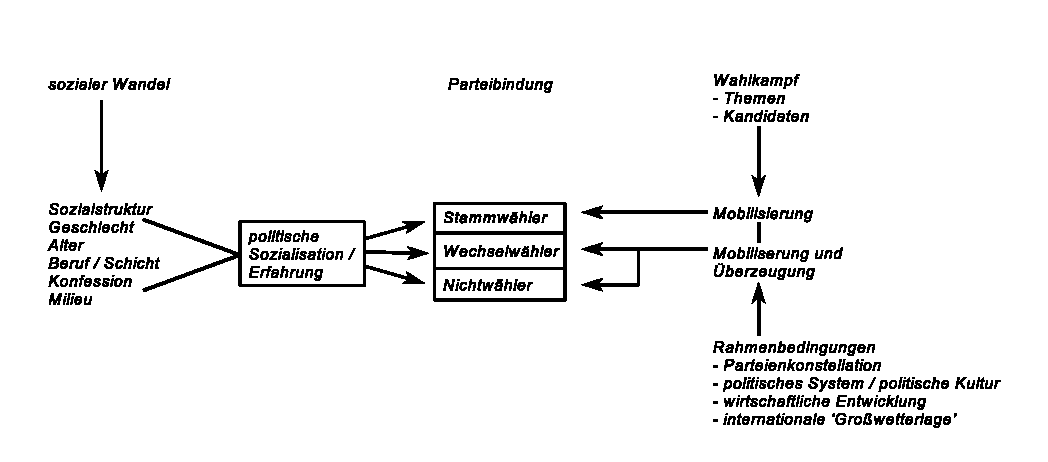
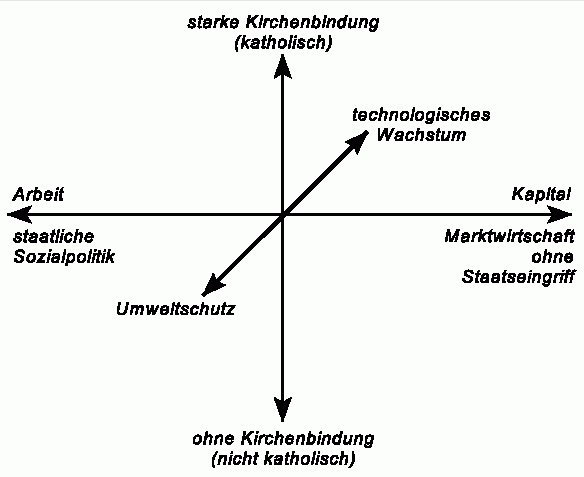
sowinet.de suchergebnis wechselwähler:
Dokument
Größe
Wahlverhalten: Sind politisch informierte Bürger eher Wechselwähler?
7.352
Quantifiziert wird nur der Anteil der dominanten Partei beim jeweils angezeigten
Typus, also eine Zahl für die Kombination aus x Merkmalen 25.088
Wahlverhalten: Meine Partei, Deine Partei? - Wie Wähler zu "ihrer"
Partei kommen. 7.039
Wahlverhalten: Sind die Wähler individualisierter geworden? 8.558
Wahlverhalten: Wahlverhalten in einer alternden Gesellschaft - entsteht eine
neue Konfliktlinie? 6.581
Sind politisch informierte Bürger eher Wechselwähler? 18.423
Wahlverhalten: Gerhard oder Helmut? - "Unpolitische" Kandidateneigenschaften
und ihr Einfluss auf die Wahlentscheidung bei der Bundestagswahl 1998 15.873
Wahlverhalten: Ostdeutsche "Landesfürsten" entscheidend für
regionale Wahlergebnisse 7.978
Sind die Wähler individualisierter geworden? 19.669
Berichte: Wölfe, Agenten und die Ordnung der Gesellschaft 14.357
Berichte: Der Homo Ludens im sozialwissenschaftlichen Seminar 32.571
Wechselwähler in Deutschland: Wählerelite oder politischer Flugsand?
Jürgen W. Falter und Harald Schoen
Das sind höchstqualifizierte 21 Seiten zum Thema!
http://www.politik.uni-mainz.de/~schoen/kaase.pdf